-
Titel des Objekts
-
Abbildung einer von einem sog. Kältefetischisten angefertigte Zeichnung (1)
-
Beschreibung des Objekts
-
Schwarz-Weiß-Fotografie einer Zeichnung, vermutlich mit Bleistift ausgeführt, die eine Winterlandschaft mit einem zugefrorenen See zeigt. In der Bildmitte sitzt auf einer Holzabsperrung eine junge Frau mit einer Mütze auf dem Kopf und Schlittschuhen an den Füßen. Sie trägt ein helles kurzes Kleid, das von einem schwarzen Gürtel gehalten wird und eine ihrer nackten Schultern freigibt. Sie hat die Arme vor der Brust verschränkt und blickt die Betrachtenden an. Sie sitzt halb seitlich auf der Holzabsperrung und setzt einen Schlittschuh auf dem Eis ab. Unten rechts im Bild steht handschriftlich: „Mein Ideal!“, unten links, ebenfalls handschriftlich: „bei -10°“.
Kontext:
Die Zeichnung stammt laut Bildunterschrift von einem sog. „Kältefetischisten“. Das Institut für Sexualwissenschaft beherbergte einige Werke dieser „Kältefetischisten“, die oft sehr ähnliche Motive aufwiesen. Von dem Zeichner existiert vermutlich mindestens eine weitere Zeichnung.
Der Sexualwissenschaftler und Sexualreformer Magnus Hirschfeld veröffentlichte diese Zeichnung zusammen mit einem Ausschnitt aus einer Zuschrift des Zeichners. Darin beschreibt dieser seine (sexuelle) Erregung, die er angesichts „abhärtender Kleidung“ bzw. „Kältekleider“ (damit ist Kleidung gemeint, die für die vorherrschenden Temperaturverhältnisse nicht warm genug sind) empfindet. Auch das Eisbaden sei Teil dieses „Interesses“, weshalb Hirschfeld hier von „Kältefetischismus“ spricht (vgl. Hirschfeld, Magnus (1920): Sexualpathologie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende, Dritter Teil: Störungen im Sexualstoffwechsel mit besonderer Berücksichtigung der Impotenz, A. Marcus & E. Webers, S. 31).
Nach der Onanie war der Fetischismus eines der ersten sexuellen Phänomene, die die Psychiater des 19. Jahrhunderts interessierten. Fetischismus wurde hier bereits, wie auch später in der Psychoanalyse, auf Assoziationen zurückgeführt. Der Sexualwissenschaftler und Sexualreformer Magnus Hirschfeld verwirft diese Theorie und entwickelt eine eigene, die konsequent von dem sexualbiologischen Ansatz ausgeht.
Sexuelle Anziehung geht nach Hirschfeld nicht von der gesamten Person aus, sondern von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Er spricht deshalb von „Teilanziehung“ oder „partieller Attraktion“. „Die Zahl der Fetische ist unbegrenzt groß. Von Kopf bis Fuß gibt es kein Fleckchen am Körper, und von der Kopfbedeckung bis zur Fußbekleidung kein Fältchen im Gewand, von dem nicht eine fetischistische Reizwirkung ausgehen könnte.“ (Hirschfeld, Magnus (1920): Sexualpathologie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende, 3. Teil, A. Marcus & E. Webers Verlag, S. 5) Da die Teilanziehung Grundlage jeder sexuellen Attraktion sei, gebe es gesunde und pathologische Fetischismen. Der gesunde Fetischismus höre dann auf, wenn die Attraktion des Partiellen – sei es Zunge oder Zopf – so überbewertet und von der Person losgelöst werde, dass diese unwichtig sei (siehe ebd.).
-
Ort
-
Berlin
-
Sprache
-
de
-
Gefördert durch
-
Förderprogramm zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin
 Magnus Hirschfeld
Magnus Hirschfeld
 Institut für Sexualwissenschaft
Institut für Sexualwissenschaft
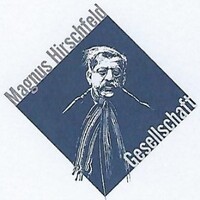 Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft
